Wie entsteht Musik? Entsteht sie als Phantasiegebilde, das im Kopf
geboren wird, aufwächst und schließlich so groß wird,
daß es aufgeschrieben werden muß? Entsteht sie als Idee, die
ähnlich einem Samenkorn ins Papier gepflanzt wird und dann durch regelmäßige
Beackerung und Pflege wächst und gedeiht? Oder ist sie nur Ventil
gesammelter Eindrücke aller Sinne, der Mischung von Bildern, Farben,
Gefühlen, alles Gelernten, eine Momentaufnahme einer persönlichen
Stimmung, vergleichbar mit Malen oder Schreiben?
Die Entstehung von Fuevo liegt irgendwo dazwischen. Zuerst nur Klänge
am Klavier, einzelne Themenfragmente, zusammenhanglos, aus einer Laune
heraus über die Finger, Tasten und Saiten in Musik umgesetzt. Die
vielfache Wiederholung formt die Melodie, den Klang, richtet die Musik
aus, stellt Zusammenhänge her, kreiert und vernichtet Ideen. Nach
und nach entsteht so ein Stück am Klavier, eine Art Improvisation,
jedoch kristallisiert sich stetig die Form - ein vierteiliges Stück
- heraus: zunächst die Einleitung, dann die Vorstellung des Hauptthemas
in Moll: mächtig im tiefen Register, die Wiederholung im hohen Register
(1. Teil). Dann ein kurzer, langsamer, lyrischer Teil, zusammen mit einem
Allegro (2. Teil) Überleitung zum zweiten Hauptthema, einer einfachen
rhythmischen Figur (3. Teil). Nach Irrungen und Wirrungen erneut das erste
Hauptthema, diesmal in Dur (4. Teil) und schließlich das majestätische
Finale mit einem fulminanten Schluß. Ist Fuevo damit fertig gewesen?
Fuevo war der Höhepunkt einer Entwicklung, die mit einfachen Melodien
am Klavier anfing, zu leichten vierstimmigen Sätzen für Jugendorchester
führte und mehrere komplexere Stücke für Blasorchester hervorbrachte.
So keimte auch bald die Idee, das Klavierstück für sinfonisches
Blasorchester umzuschreiben. Oder zu arrangieren? Oder zu komponieren?
Die Besetzung entspricht dem eines sinfonischen Blasorchesters. Auf
Piccolo habe ich bewußt verzichtet, Oboe ist ad lib. Der Holzsatz
besteht aus zwei Flöten, drei Klarinetten, Baßklarinette und
Fagott, der Saxophonsatz aus zwei Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon. Das
hohe Blech ist in zwei Trompeten und zwei Flügelhörner aufgeteilt,
kann jedoch auch von vier Trompeten gespielt werden. Vier Hörner,
drei Posaunen, Tenorhorn, Bariton/Euphonium und Tuba bilden das tiefe Blech.
Hinzu kommen noch Pauken, Glockenspiel sowie Schlagwerk (Becken, kleine
und große Trommel) bzw. kombiniertes Schlagzeug.
Die Einleitung besteht einem zweifachen Frage-Antwort-Spiel: auf die
„Frage“ des Orchesters „antworten“ Tenorhorn und Klarinette. Dann das Hauptthema,
vorgestellt von Tenorhorn, Bariton, Tuben und Fagott (s. Notenbeispiel
1).
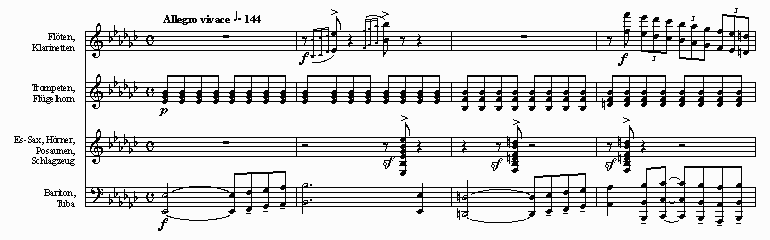
Notenbeispiel 1: Takt 12 bis 15, Hauptthema im tiefen Register
Es wird rhythmisch und harmonisch gestützt vom hohen Blech. Explosionsartige
Einwürfe der Flöten, Klarinetten, Hörner, Posaunen und Schlagwerk
verstärken die Melodie. War die ursprüngliche Tonart der Einleitung
C-dur und die des Hauptthemas c-moll, so änderte ich die Tonart mit
Rücksicht auf die Lage der einzelnen Register in Es-dur bzw. es-moll,
mit besonders für Flöte und Fagott anstrengenden sechs b. Adagio
und zweites Hauptthema ließ ich im Spannungsfeld von G-dur und g-moll,
um dann zum Schluß nach B-dur zu wechseln.
Doch nun zurück zum Stück. Nach einem kurzen Intermezzo wird das Hauptthema vom hohen Blech und Es-Alt-Saxophon übernommen, umspielt mit doppeltem Kontrapunkt in
Klarinetten und Flöten (s. Notenbeispiel 2). Rhythmisches Element
ist eine Glocke von den Tuben, über die Hörner zu den Flügelhörnern.
Der erste Höhepunkt ergibt sich durch Dehnung eines Teilmotivs, bei
dem Holzregister und Hörner miteinander wettstreiten. Eine Variation
des ersten Intermezzos mit anschließender Modulation führt zum
Adagio in strahlendem G-dur.
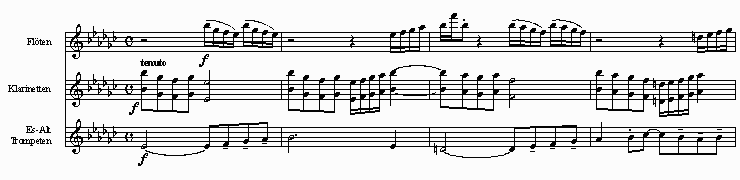
Notenbeispiel 2: Takt 30 bis 33, Hauptthema im hohen Register und Kontrapunkte
Harmonisch und thematisch basiert dieser erste Teil auf der Klaviervorlage.
Bei der Erstellung der Partitur hatte ich jedoch so viele (zu viele) Ideen,
die erst beim Schreiben oder beim Lesen der ausgedruckten Seiten entstanden,
daß ich viele Passagen abänderte. Insbesondere die Ideen für
die Kontrapunkte, Einwürfe und die abschließende Modulation
kamen beim Erstellen der Partitur hinzu.
Im Adagio darf das Bariton oder Euphonium seine solistischen Qualitäten
herausstellen (s. Notenbeispiel 3). Neckische Einwürfe von den Flöten
sowie kurze solistische Passagen einzelner Instrumente umrahmen den Solisten.
Wichtig ist hier die Transparenz und die überzeugende Darbietung der
einzelnen Melodien.
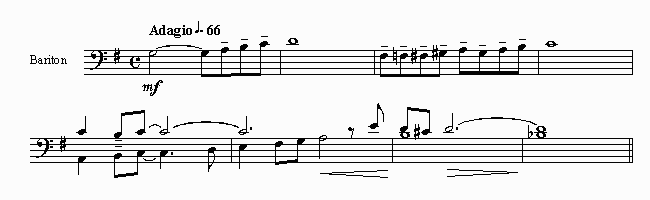
Notenbeispiel 3: Takt 55-62, Solo im Bariton
Im darauffolgenden Allegro werden die Vorbereitungen zum zweiten Hauptthema
getroffen. Überleitungsthema ist eine einfache Tonleiter über
eineinhalb Oktaven, gefolgt von stark rhythmisierenden Sechzehnteln (s.
Notenbeispiel 4). Auch hier findet sich - wenn auch nur im Kleinen - die
Aufteilung der Melodie des Themas auf tiefe und hohe Register, wobei die
Melodie durch kleine harmonische Veränderungen weiterentwickelt wird.
In kurzen humoresken Phrasen wird auch schon dem zweiten Hauptthema vorgegriffen.
Ende dieses Teils ist eine fallende Achtellinie, die von ganz oben in den
Flöten bis zu den Tuben in einen Halbschluß mündet.
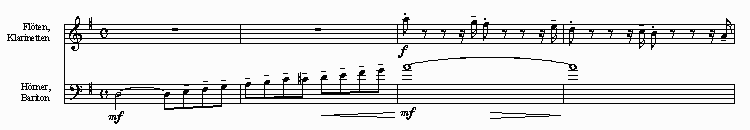
Notenbeispiel 4: Takt 75-78, Überleitungsthema
Sehr hilfreich bei der Erstellung der Partitur ist die heute verfügbare
Computersoftware. Mittels copy&paste, Transpositionsfunktionen, Notenschlüsseländerungen
und einer flexiblen Noteneingabe bieten die Notationsprogramme Möglichkeiten,
die die Kreativität nicht nur fördern, sondern vielmehr auch
entstehen lassen. Je einfacher Änderungen durchzuführen sind,
desto eher ist man geneigt, das eine oder andere auch einmal auszuprobieren.
Ist die Veränderung nichts, so greift man einfach auf die gespeicherte
Kopie zurück oder macht alle Änderungen rückgängig.
Dieses Herumspielen soll und kann nicht die Planung der Partitur ersetzen.
Ein gewisser Faktor Zufall schadet jedoch nicht.
Das zweite Hauptthema (s. Notenbeispiel 5a) tritt in nahezu allen Registern
und Tonlagen auf. Zu Anfang nur spärlich instrumentiert, nimmt es
immer konkretere Form an, wird mehrstimmig, augmentiert und diminuiert.
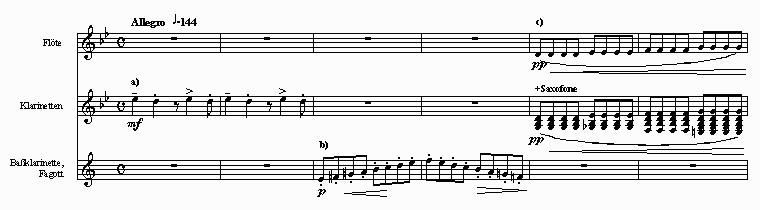
Notenbeispiel 5: Takt 112-117, zweites Hauptthema, Unruheherd und Klangteppich
Sehr hilfreich bei der Erstellung der Partitur ist die heute verfügbare
Insgesamt wirkt dieser Teil sehr hektisch, was durch verschiedene Taktartwechsel
noch unterstrichen wird. Ein weiterer Unruheherd ist eine Achtelbewegung
in harmonisch g-moll, eine um eine kleine None aufsteigende und fallende
Linie, die kanonartig in immer kürzer werdenden Abständen alle
Instrumente durchwandert (s. Notenbeispiel 5b). Als ruhiger Gegenpol dazu
habe ich einen Klangteppich aus sich immer weiter auffächernden Akkorden
gewebt, die - zuerst im Holzregister, dann im Blech und schließlich
tutti - vom pianissimo zum fortissimo crescendieren (s. Notenbeispiel 5c).
Diese ganze Turbulenz mündet schließlich in den
Das erste Hauptthema wird hier in B-dur wiederholt. Wiederum hat das
tiefe Blech das Kommando. Klarinetten und Flöten bilden den harmonischen
Hintergrund. Ein ruhiger Rhythmus vom kombinierten Schlagzeug läßt
zusammen mit den jazzartigen Begleitfiguren im hohen Blech das Hauptthema
erfrischt erscheinen. Nach einem chromatisch aufsteigenden Teilmotiv mündet
das Hauptthema in die Schlußsequenz: Majestätisch erhebt sich
über dem G-dur- bzw. g-moll-Akkord des Orchesters ein Hornmotiv (s.
Notenbeispiel 6), das als Spannungston jeweils die große Septime
besitzt. Mit einem Paukenschlag schließlich wird das Presto eingeleitet:
wuchtige Akkordblöcke in g-moll und H-dur, dazwischen solistische
Pauken. Schlußton ist das unisono G, auf jedem Instrument in der
tiefen Lage.
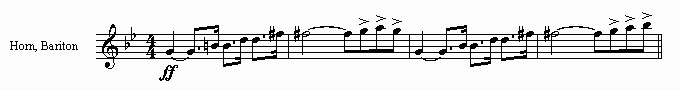
Notenbeispiel 6: Takt 189 bis 192, Hornmotiv
Während der Arbeit an einem Stück muß man sich auch
Gedanken über den Namen machen. Einerseits soll er gut zum Stück
passen und andererseits soll er originell und nicht abgenutzt klingen.
Als Arbeitstitel nehme ich oft den ersten Namen, der mir spontan zu einem
Stück einfällt. Meistens habe ich mich dann so an diesen Namen
gewöhnt, daß ich ihn beibehalte.
Während eines zweiwöchigen geschäftlichen Aufenthalts
in Buenos Aires, während dem ich den ersten und zweiten Teil orchestrierte,
reifte die Idee heran, einen spanischen Titel - obwohl ohne Zusammenhang
zum Stück - zu wählen. „Feuer“ erschien mir passend. In der (irrigen)
Annahme, Feuer hieße auf Spanisch „Fuevo“, hatte ich dann den Titel.
Obwohl es korrekt „Fuego“ heißt, beließ ich es bei „Fuevo“,
da er ebenfalls Spanisch klingt und etwas Geheimnisvolles an sich hat (und
weil mir „Fuevo“ besser gefiel).
|
Geschichte zu „Fuevo“ |
|
Home |
Im Nachhinein entstand auch eine Geschichte zum Stück, die, wie
ich finde, ganz gut paßt, aber trotzdem Widersprüche zur Komposition
beinhaltet. Darin könnte „Fuevo“ ein Schiff sein, das in sturmumtobter
See doch noch einen Weg aus dem Unwetter findet (1. Teil, Adagio). Nach
flotter Weiterfahrt (2. Teil) wird eine Insel entdeckt, die sogleich erkundet
wird. Dabei verirrt sich die Mannschaft, findet jedoch wieder den Weg aus
der Irre (3. Teil). Da die Insel unwirtlich und uninteressant ist, wird
weitergesegelt. Erneut gerät das Schiff in einen Sturm, der Mast bricht
und „Fuevo“ wird auf dem Meeresboden versenkt (4. Teil, Schluß).
Ein tragisches Ende, doch ist es auch in der Komposition so angelegt und
beabsichtigt.
Die ganze Geschichte ist im Internet unter www.fuevo.de nachzulesen.
Hier können auch Probepartituren im Acrobat Reader-Format und viele weitere Informationen abgerufen werden.
„Fuevo“ wurde im Rahmen des Werkstattkonzertes der 3. Komponistenwerkstatt
am 9.11.1998 vom Rundfunkblasorchester Leipzig unter Leitung von Jochen
Wehner uraufgeführt. Eine Aufführung der sinfonischen Fassung erfolgte am 14. und 15. April 2000 durch das Schulorchester der Freien Waldorfschule Heilbronn.
|
(c) 2000 dvo ? Druck und Verlag Obermayer, D-86807 Buchloe |
|
Home |